Dämmstoffe
Diskrepanz zwischen realen Messwerten und Normwerten


Ökologische Dämmstoffe verringern in der Praxis den Wärmeverlust effektiver als konventionelle Dämmstoffe. Warum haben sie trotzdem rechnerisch schlechtere Normwerte?
Die physikalische Dämmleistung eines Baustoffes setzt sich aus zwei Faktoren zusammen:
Die Dämmleistung ergibt sich durch das Zusammenspiel beider Faktoren: Bei Polysterol beispielsweise sind die vielen abgeschlossenen Poren gut – noch besser sind Kügelchen, die vakuumisiert sind. Das umgebende Material ist aber sehr leicht. Bei faserigen Dämmstoffen sind die Poren weniger ideal. Hier kommt es auf die spezifischen Eigenschaften des umgebenden Materials an.
Organisches Material wie Holz oder Zellulose schneiden hier besser als mineralische Stoffe ab. Ihre Fasern verfügen über eingeschlossene Luftkammern, die die Wärmedämmung unterstützen.
Schaut man in die maßgebliche DIN 4108, weisen konventionelle Dämmstoffe bessere Lambda-Werte auf, sind also scheinbar besser – auch wenn das Praxisbeispiel in der Ausstellung etwas anderes zeigt.
Mit dem Lambda-Wert wird die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes ausgedrückt, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen – je niedriger, desto besser. Per Definition beschreibt er als standardisiertes Maß die Wärmemenge, die in einer Sekunde durch ein bestimmtes Material mit 1 Quadratmeter Fläche und 1 Meter Dicke hindurchfließt.
Beim Vergleich der Lambda-Werte sollten zwei Faktoren im Hinterkopf behalten werden:
Der Lambda-Wert ist die Grundlage für die Berechnung des U-Werts, der den (theoretischen) Wärmedurchgang eines konkreten Bauteils beschreibt – beispielsweise einer Wand oder eines Daches. Für das Gebäudeenenergiegesetz (GEG) ist der U-Wert eine wichtige Größe, für die sie Grenzwerte festschreibt. Die Einhaltung dieser Werte kann besonders bei der Finanzierung mit KfW-Mitteln oder dem Verkauf der Immobilie relevant sein.
Ein „schlechter“ Lambda-Wert führt also zu einem schlechteren U-Wert. Dies muss – vorausgesetzt man möchte oder muss die festgeschriebenen Grenzwerte einhalten – durch eine größere Materialstärke kompensiert werden. Die Konstruktion wird dicker, was wiederum zulasten der Innenraumgröße gehen kann oder andere baukonstruktive Probleme aufwirft und sich preislich niederschlägt.
Dennoch lohnt sich der Einsatz von nachwachsenden Dämmstoffen: Die reale Dämmleistung übertrifft die rechnerischen Werte. Dadurch geht effektiv noch weniger Wärme verloren und die nutzungsbasierte Ökobilanz fällt positiv aus. Dies wird ergänzt durch eine bessere Ökobilanz bei der Herstellung der Baustoffe sowie einem möglichen Recycling am Ende der Lebensdauer des Gebäudes.
Alle Baustoffe, und in besonderem Maße Dämmstoffe, unterliegen einem strengen Prüfverfahren. Zugelassene Naturbaustoffe werden dabei hinsichtlich Schimmel mit sieben unterschiedlichen Pilzen einschließlich einer definierten Menge Nährstoffe geimpft. Die natürlichen fungiziden Zuschläge (oft Borsalz bei Naturbaustoffen oder Gerbsäureverbindungen aus dem Eichenholz) müssen dann dafür sorgen, dass kein Pilzwachstum trotz geimpfter Pilzsporen und Nährlösung stattfindet.
Naturdämmstoffe haben gerade bei kritischen feuchtdynamischen Zuständen Vorteile gegenüber anderen synthetischen Materialien. Sie sind in der Lage, molekular Feuchte einzulagern - d.h. im Material selbst und eben nicht in der Luftpore, die für die eigentliche Dämmleistung verantwortlich ist. Diese eigenschft lässt sich sogar in den Zulassungen ablesen. Beispielsweise beträgt die maximale massenbezogene Feuchte bei Minerallwolldämmstoffen lediglich 4 Prozent, während Naturbaustoffen bis zu 20 Prozent zugestanden werden. Es gibt eine Reihe von praktischen Bauvorhaben, die hinsichtlich ihres feuchtdynamischen Verhaltens nur mit Naturdämmstoffen funktionieren bzw. teilweise durch Austausch von Mineralwolle gegen Naturdämmstoffe die Konstruktion "geheilt" haben.
Was Nagetiere betrifft, lässt sich festhalten, dass es grundsätzlich nur sehr wenige nagetiersichere Dämmstoffe gibt. Außerdem spielen Nagetiere als Schädlinge im und am Haus generell, nicht nur in Bezug auf Dämmungen, eine Rolle - neben Vögeln, die Polystyroldämmung heraushacken und dort Nester bauen, was ihnen beim Naturbaustoff Holzfaser nicht gelingt. Bei Nagern und auch Mardern konnte beobachtet werden, dass sie mit Borsalz versetzte Naturbaustoffe eher stark meiden, da das Salz ihnen nicht schmeckt und sie austrocknen lässt.
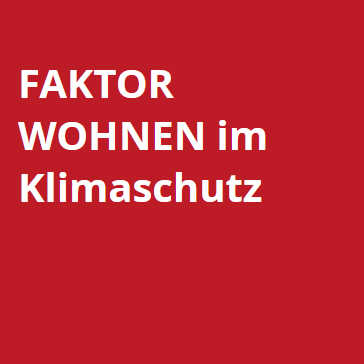
Gute Argumente für den Einsatz ökologischer Baustoffe in der Gebäudedämmung
Konkrete Argumente für den Einsatz von Dämmstoffen aus organischen Rohstoffen
Forderungen für ökologische Dämmstoffe
Weitere Informationen